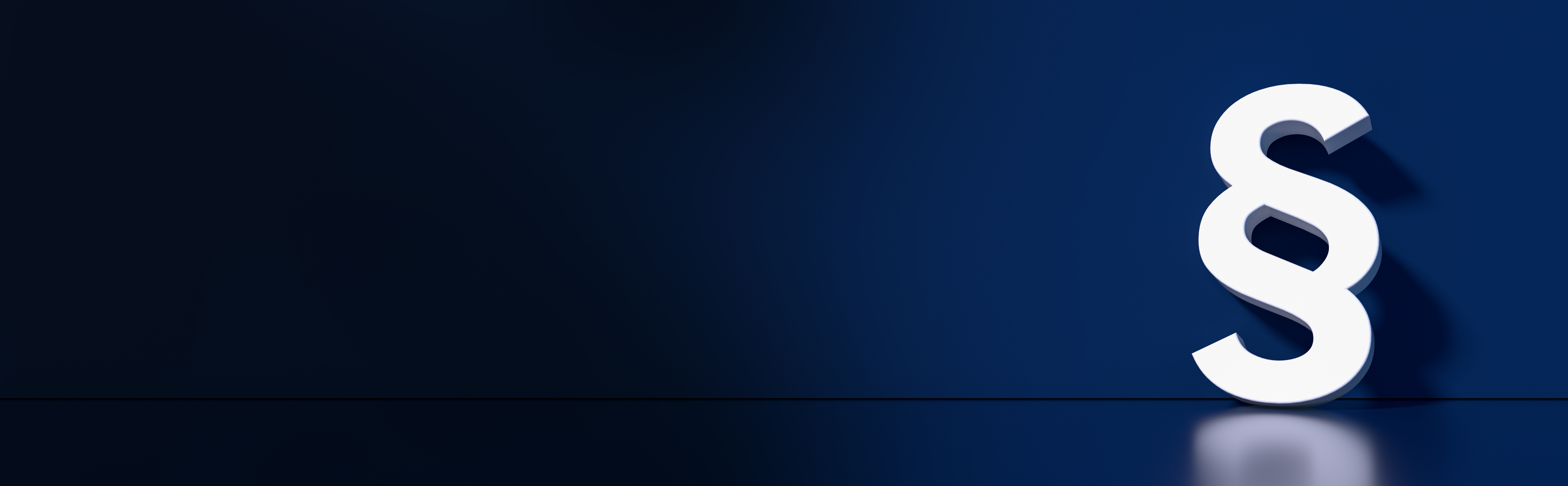Eigenbedarfskündigung und Härtefall: Ihr umfassender Leitfaden im Mietrecht 2025
Rechtsanwalt Mietrecht Telgte: Rat zu Eigenbedarfskündigung & Härtefall – schützen Sie Ihre Rechte, lassen Sie sich jetzt professionell beraten und vertreten!

Mit mehrjähriger Erfahrung als Rechtsanwalt verfüge ich über fachliche Expertise und die notwendigen Kenntnisse, um Ihre rechtlichen Anliegen effektiv zu lösen.
.jpg)

Lesen Sie mehr zum Thema (Eigenbedarfs-)Kündigung und Härtefallen hier
Einleitung
Die Eigenbedarfskündigung zählt nicht nur zu den am stärksten diskutierten, sondern auch zu den emotional und rechtlich anspruchsvollsten Problemfeldern im deutschen Mietrecht. Als Vermieter stehen Sie vor der Herausforderung, ein formell korrektes und materiell gerechtfertigtes Kündigungsverfahren anzustreben, sodass Ihr Bedürfnis nach Eigennutzung des Wohnraums rechtlich Bestand hat – auf der anderen Seite erleben Mieter durch eine drohende Kündigung regelmäßig massive Einschnitte in ihre persönliche Lebensgestaltung, die nicht selten als existenzbedrohend wahrgenommen werden. Die gesetzgeberische Ausgestaltung und die höchstrichterliche Rechtsprechung sind darauf ausgelegt, zwischen diesen gegenläufigen Grundinteressen einen gerechten Ausgleich herzustellen. Dabei kommt der verfassungsrechtlichen Wertung, insbesondere der Wechselwirkung zwischen Eigentumsgarantie, Sozialpflichtigkeit sowie dem Schutz des Wohnraums als Lebensmittelpunkt, eine zentrale Rolle zu. Als Rechtsanwalt aus Telgte kann und werde ich Sie sowohl als Vermieter oder betroffener Mieter bundesweit vorgerichtlich als auch in einer wegen der Eigenbedarfskündigung eingeleiteten Räumungsklage rechtlich betreuen.
Im Folgenden erhalten Sie eine vertiefte Darstellung sämtlicher praxisrelevanter Fragestellungen zur Eigenbedarfskündigung, zur Interessenabwägung und zu allen Instrumenten des Mieter- wie auch des Vermieterschutzes.
I. Verfassungsrechtliche und rechtliche Grundlagen der Eigenbedarfskündigung
1. Die Eigenbedarfskündigung im Gefüge von Eigentumsschutz und Mieterschutz
Bevor Sie sich mit den Einzelheiten eines konkreten Eigenbedarfsvorhabens oder einer drohenden Kündigung auseinandersetzen, empfiehlt es sich, die unions- und verfassungsrechtliche Grundentscheidung vor Augen zu führen. Der Gesetzgeber hat die Kündigungsmöglichkeiten des Vermieters bewusst restriktiv ausgestaltet, um einerseits die Eigentumsfreiheit und Nutzungsbefugnis nach Art. 14 Abs. 1 GG, andererseits den von Art. 13 GG und dem Sozialstaatsprinzip besonders geschützten Wohnraum als Lebensmittelpunkt des Mieters miteinander ins Gleichgewicht zu bringen. Daraus folgt, dass die Eigenbedarfskündigung nur als Ausnahme vom Grundsatz des Bestandsschutzes zu verstehen ist und strengen Voraussetzungen sowie rechtlichen Kontrollen unterliegt. BVerfG, Beschluss vom 13.10.1993 – 1 BvR 1693/92
2. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine zulässige Eigenbedarfskündigung
Die Eigenbedarfskündigung beruht auf § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB und setzt voraus, dass der Vermieter die Wohnung für sich selbst, für Familienangehörige oder für Personen seines Haushalts als Wohnraum benötigt. Es ist jedoch keinesfalls ausreichend, einen beliebigen Eigenbedarf abstrakt in Aussicht zu stellen; es muss vielmehr zum Zeitpunkt der Kündigung ein tatsächlicher, gegenwärtiger und nachvollziehbarer Wille zur (Eigen-)Nutzung bestehen. Dies gilt insbesondere auch für die Personenkreise, für die Sie Eigenbedarf anmelden möchten. Die Rechtsprechung ist insoweit streng: Je entfernter das Verwandtschaftsverhältnis und je weniger plausibel oder dringend der festgestellte Nutzungswunsch, desto intensiver sind Gerichte gehalten, die Entscheidung anhand der Gesamtumstände kritisch zu prüfen. (BGH, Urteil vom 18.05.2005 – VIII ZR 368/03)
Tabellarische Übersicht eigenbedarfsberechtigter Personen
Die Kündigung selbst muss zudem gewissen Formvorschriften entsprechen (lesen Sie hierzu den Fachartikel: Kündigung des Mietverhältnisses)
Exkurs Formalien einer Kündigung nach deutschen Mietrecht:
In Deutschland müssen Kündigungen bestimmte Formanforderungen erfüllen, um rechtswirksam zu sein. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen Textform und Schriftform zu verstehen und zu wissen, dass eine Kündigung dem Empfänger zugehen muss, um wirksam zu werden. Hier sind die Details:
Schriftform vs. Textform
Schriftform
- Definition: Die Schriftform erfordert, dass ein Dokument eigenhändig unterschrieben wird. § 126 BGB
- Anforderungen:
- Die Kündigung muss in Papierform vorliegen.
- Sie muss die eigenhändige Unterschrift des Kündigenden tragen.
- Elektronische Signaturen oder Faxkopien genügen nicht.
Textform
- Definition: Die Textform ist weniger streng als die Schriftform. Sie erfordert, dass die Erklärung in einer dauerhaften Form festgehalten wird, aber keine eigenhändige Unterschrift.
- Anforderungen:
- Die Erklärung kann per E-Mail, Fax oder auf anderem elektronischen Medium erfolgen.
- Sie muss den Namen des Erklärenden enthalten.
Unterschied
- Verwendung: Während die Textform für viele Verträge oder Erklärungen ausreichend ist, ist für Kündigungen von Arbeitsverhältnissen die Schriftform vorgeschrieben.
- Rechtliche Relevanz: Eine Kündigung in Textform wäre nicht rechtswirksam, wenn das Gesetz die Schriftform verlangt.
Zugang der Kündigung
Für die Wirksamkeit der Kündigung ist zusätzlich der Zugang entscheidend:
- Definition: Der Zugang bedeutet, dass die Kündigung in den Machtbereich des Empfängers gelangt, sodass dieser unter normalen Umständen die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hat.
- Beispiele des Zugangs:
- Die Kündigung erreicht den Empfänger per Post und wird ihm zugestellt.
- Übergabe der Kündigung persönlich gegen Empfangsbestätigung.
- Zeitpunkt des Zugangs: Der Zugang tritt ein, wenn der Empfänger üblicherweise davon Kenntnis nehmen kann – bei postalischer Zustellung also oft am Tag des Einwurfs in den Briefkasten.
Somit müssen für eine wirksame Kündigung in Deutschland die Schriftform eingehalten und der Zugang der Kündigung sichergestellt werden. Nur dann entfaltet die Kündigung ihre rechtliche Wirkung. Der Vermieter ist darlegungs- und beweisbelastet für die Wirksamkeit. Stellen Sie bei Ausspruch einer Kündigung sicher, dass sämtliche Vermieter (bei Personenmehrheit!) diese unterschreiben und das Schreiben nachweisbar zugeht. Bitten Sie Freunde oder Verwandte sich das Schreiben durchzulesen und zu beobachten wie Sie das Schreiben einkuvertieren und es per Einwurfeinschreiben versenden. Die Zeugen müssen beobachten wie Sie Schreiben einkuvertieren und per Einwurfeinschreiben versenden.
.jpg)
Eine formwirksame Kündigung muss im Detail enthalten:
- Die genaue Bezeichnung der Wohnung sowie aller Mieter
- Die präzise Benennung der Person(en), für die der Eigenbedarf beansprucht wird, nebst Darlegung ihres Verhältnisses zum Vermieter
- Eine ausführliche, individuelle Begründung, aus der sich ergibt, aus welchen Lebensumständen und Motiven die Nutzung erforderlich wird (z. B. Arbeitswechsel, Familienzuwachs, Pflegefall)
- Die Angabe korrekter Kündigungsfristen
- Den ausdrücklichen Hinweis auf das gesetzliche Widerspruchsrecht des Mieters
Praxistipp:
Achten Sie in jedem Fall genau auf Wahrheit und Aktualität Ihrer Angaben. Bei der Frage, ob Eigenbedarf tatsächlich zum Kündigungszeitpunkt besteht und weiterhin Bestand hat, gibt es keinen Spielraum. Fällt zum Beispiel der ursprünglich benannte Grund nach Zugang der Kündigung fort, so sind Sie als Vermieter zur sofortigen Mitteilung verpflichtet – andernfalls laufen Sie Gefahr, dass die Kündigung nachträglich als unwirksam betrachtet wird. Sollten Sie den Eigenbedarf vortäuschen droht Ihnen als Vermieter in die Schadenersatzpflicht zu geraten. Diese kann ausufern. Als Rechtsanwalt aus Telgte habe ich einen gekündigten Mieter, der Opfer eines vorgetäuschten Eigenbedarfs gewesen ist, dabei unterstützt Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Hierbei umfasste der Schadenersatz die erhöhte Miete für eine angemessene Ersatzwohnung (zeitlich nicht befristet!), die Anschaffung eines Gebrauchtwagens (damit der Gekündigte seine Arbeitsstelle in das nunmehr 20 km entfernte Telgte erreichen konnte), die Umzugskosten und diverse Anschaffungskosten für Einrichtungsgegenstände. Sie sehen: Als Vermieter können Sie sich hohen Schadenersatzforderungen aussetzen. Lassen Sie sich durch einen Anwalt beraten, wenn Sie Eigenbedarf anmelden möchten.
II. Missbrauch und Schadenersatz bei (vorgetäuschtem) Eigenbedarf und unzulässiger Vorratskündigung
In der Praxis der Eigenbedarfskündigung kommt es immer wieder vor, dass Mieter die Ernsthaftigkeit oder Wahrheit des geltend gemachten Bedarfs in Zweifel ziehen – nicht selten mit Erfolg. Die Gerichte prüfen solche Fälle besonders streng, da ein Missbrauchsverdacht das gesamte Vertrauen in den Schutzmechanismus unterlaufen würde.

1. Wann liegt ein Missbrauch wegen vorgetäuschtem Eigenbedarf vor? – Voraussetzungen und Fallgruppen aus der Rechtsprechung
Ein vorgetäuschter Eigenbedarf ist dann gegeben, wenn der angebliche Nutzungswunsch nur vorgeschoben wird, um z. B. einen Altmieter mit günstiger Vertragslage loszuwerden, die Wohnung teurer oder an Bekannte zu vermieten, oder nach Modernisierung „lukrativer“ nutzen zu können. Ein sachlich nicht belegter, willkürlich oder wechselnd benannter Eigenbedarf, den der Vermieter gar nicht realisieren will (oder die Person überhaupt nicht benutzt), führt stets zur Unwirksamkeit der Kündigung und kann ernste Folgen nach sich ziehen.
Typische Indizien für den Missbrauch des Eigenbedarfs
- Die tatsächlich genutzte Wohnung bleibt nach Auszug längere Zeit leer oder wird – entgegen den Angaben – nicht zu Wohnzwecken, sondern zum Beispiel gewerblich genutzt.
- Der angeblich Eigenbedarf beanspruchende Angehörige bezieht die Wohnung nicht, sondern der Vermieter verkauft diese umgehend weiter oder schließt einen neuen Mietvertrag ab.
- Es werden im engen zeitlichen Abstand weitere Kündigungen mit immer neuen „Bedürftigen“ ausgesprochen.
- Die Begründung des Bedarfes ist erkennbar nicht nachvollziehbar, widersprüchlich oder pauschal gehalten.
- Dem Vermieter steht vergleichbarer freier Wohnraum im Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung zur Verfügung, welchen er vorrangig nutzen könnte.
Konsequenzen:
Der Mieter hat Anspruch auf (vollen) Ersatz des Schadens, welcher ihm daraus erwächst, dass ihm die Wohnung zu Unrecht gekündigt worden ist. Das heißt sämtliche nachweisbarer Kosten, die infolge des Umzugs entstanden sind – dazu zählen höhere Mieten, Maklerprovisionen, Umzugskosten, Renovierungsaufwendungen und unter Umständen sogar Ersatz für erlittene Vermögensnachteile.
In Extremfällen kann eine strafrechtliche Relevanz des Verhaltens des Vermieters gegeben sein, die eine Anklage nach sich zieht.
2. Vorratskündigung
Bei der Vorratskündigung handelt sich nicht um das Vortäuschen eines Eigenbedarfs, kann jedoch die gleichen Schadenersatzpflichten auslösen.
Vorratskündigung: Der Vermieter kündigt präventiv und ohne aktuellen konkreten Anlass, mit dem Ziel, für zukünftige, eventuell eintretende Gründe gerüstet zu sein. Eine unzulässige Vorratskündigung im Mietrecht liegt also vor, wenn ein Vermieter eine Kündigung ohne einen konkreten Kündigungsgrund ausspricht, um sich für die Zukunft eine Möglichkeit offen zu halten, den Mietvertrag zu beenden.
III. Die Interessenabwägung – Das Herzstück des Härtefallschutzes
Wenige Aspekte des Mietrechts sind für die Rechtspraxis derart zentral, aber auch so situationsabhängig und vielschichtig wie die vorzunehmende Interessenabwägung im Kontext des § 574 BGB. Sie dient dazu, in jedem einzelnen Streitfall zu klären, ob und wie lange die Vollziehung des Eigenbedarfs hinter den individuell nachgewiesenen Bedürfnissen des Mieters zurücktreten muss.

1. Maßstäbe und Prinzipien der Abwägung
Die Interessenabwägung ist kein bloß schematisches Abhaken bestimmter Kriterien. Vielmehr ist es Aufgabe des Gerichts, alle Umstände des Einzelfalles vollkommen frei, unter Berücksichtigung aller sozialen, gesundheitlichen, familiären und wirtschaftlichen Faktoren zu würdigen. Maßgeblich ist, ob der Nachteil für den Mieter „unter Berücksichtigung aller berechtigten Interessen der Parteien nicht zu rechtfertigen“ ist, wie es der Gesetzeswortlaut fordert. Dabei umfasst die Abwägung beispielsweise folgende Parameter:
- Das Ausmaß und die Intensität der Beeinträchtigung des Mieters (z. B. Alter, Gebrechlichkeit, Krankheit, Dauer der Mietzeit),
- Die sozialen und familiären Bindungen im Wohnumfeld,
- Die Möglichkeiten und Zumutbarkeit alternativer Wohnraumversorgung,
- Die Dringlichkeit und Plausibilität des Nutzungswunsches auf Vermieterseite,
- Wirtschaftliche oder berufliche Existenzfragen auf beiden Seiten.
Beispielhafte Konstellationen
Ein 87-jähriger Mieter, der seit über 30 Jahren ununterbrochen in derselben Wohnung lebt und für den ein Umzug nachweislich eine erhebliche Gesundheitsverschlechterung oder sogar Lebensgefahr bedeuten würde, genießt – insbesondere dann, wenn keine zumutbare Ersatzwohnung auffindbar ist – häufig auch gegen gewichtige Vermieterinteressen einen Fortsetzungsanspruch, teils sogar auf unbestimmte Zeit. Anders ist der Fall zu beurteilen, wenn der Eigenbedarf einen pflegebedürftigen Angehörigen oder die Gründung einer Familie umfasst und der Mieter keine gravierenden Härten geltend machen kann.
2. Tabellarischer Vergleich typischer Abwägungssituationen
3. Besonderheiten der befristeten Fortsetzung
Gerichte haben die Möglichkeit, bei nur vorübergehenden Härtegründen (etwa während einer Krankheit, Schwangerschaft oder Pflegephase) die Fortsetzung des Mietverhältnisses befristet anzuordnen. Dies sichert die Belange beider Parteien in gerechter Weise.
IV. Härtefallkonstellationen im Lichte der Rechtsprechung
(Mit Praxisbeispielen, Quellen und Einordnung)
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht und Erläuterung der wichtigsten Härtegründe, deren Geltendmachung besonders erfolgversprechend ist – immer versehen mit Hinweisen auf Belegpflichten, rechtliche Anforderungen und typische Fehlerquellen.
1. Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Verwurzelung
Das Zusammenspiel aus Lebensalter, gesundheitlicher Disposition und sozialer Einbindung bildet den „Klassiker“ des Härtefalls – aber eben nicht jeder Rentner ist automatisch vor Kündigung geschützt.
Beispiel:
Ein 78-jähriger Mieter mit schweren Herzproblemen, dessen gesamter Bekanntenkreis sowie behandelnde Ärzte in der unmittelbaren Umgebung ansässig sind, kann belegen, dass ein Umzug kaum zu kompensierende Risiken für seine Gesundheit und Selbständigkeit bereithält. Hinzutritt die jahrzehntelange Bindung an Wohnung, Umfeld, Einkaufsmöglichkeiten und Nachbarschaft. In solchen Fällen entscheiden Gerichte regelmäßig zugunsten des Mieters – vorausgesetzt, die Gefahren werden durch fachärztliche Atteste hinreichend belegt. (AG Bayreuth, Urteil 4 C 78/89)
2. Psychische Ausnahmelagen und Suizidgefahr
Sind erhebliche psychische Risiken im Falle eines Wohnungsverlustes zu erwarten – bis hin zu erhöhter Suizidgefahr –, so sind Gerichte gehalten, selbst bei gewichtigen Eigenbedarfsgründen zumindest eine vorübergehende/probeweise Fortsetzung anzuordnen. Letztlich ist in diesen Fällen die Vorlage umfassender fachärztlicher Gutachten nahezu unentbehrlich. (BVerfG, Beschluss 1 BvR 1147/97)
3. Schwangerschaft und besondere familiäre Konstellationen
Gerade im letzten Drittel einer Schwangerschaft oder in der sensiblen Phase nach Geburt gilt ein Umzug regelmäßig als unzumutbare Härte – sowohl für die Mutter als auch für das Neugeborene. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass unter normalen Umständen mindestens 8–12 Wochen nach der Geburt von einer Fortsetzung des Mietverhältnisses auszugehen ist. (LG Stuttgart, Urteil 16 S 378/90)
4. Fehlende Ersatzwohnmöglichkeit trotz umfassender Suche
Der bloße Hinweis auf Wohnungsknappheit oder erhöhte Preise genügt jedoch nicht, um als Härtefall anerkannt zu werden. Es bedarf einer nachweislich engagierten, ernsthaften Suche, die idealerweise durch eine detaillierte Dokumentation aller Anfragen, Besichtigungen und Absagen belegt werden kann. Fehlt ein solches aktives Bemühen, wird das Gericht den Härtefalleinwand in der Regel zurückweisen. (AG Mannheim, Urteil 14 C 29/09)
5. Berufliche und wirtschaftliche Existenzgefahr
Zieht die berufliche Tätigkeit, etwa die Ausübung eines freien Berufs oder einer Home-Office-Tätigkeit, die Notwendigkeit eines Verbleibs in der Wohnung nach, so kommt eine Härte ebenfalls infrage – beispielsweise, wenn ein kurzfristiger Umzug zur Aufgabe oder existenzbedrohenden Unterbrechung der Erwerbstätigkeit führen würde.
V. Schutzinstrumente: Widerspruch, Räumungsfrist, Vollstreckungsschutz – Ablauf & Details
1. Der Widerspruch nach § 574 BGB im Überblick
Sobald Sie eine Eigenbedarfskündigung erhalten haben, steht Ihnen – bei Vorliegen der oben skizzierten Härtegründe – das Recht zu, der Kündigung zu widersprechen. Die Ausübung dieses Rechts ist allerdings an bestimmte formelle und materielle Anforderungen geknüpft:
2. Die Räumungsfrist nach § 721 ZPO
Falls Sie als Mieter im Räumungsprozess unterliegen, steht Ihnen das zusätzliche Schutzinstrument der Räumungsfrist zur Verfügung. Insbesondere aus humanitären und sozialen Gründen (z. B. gravierende gesundheitliche Probleme, laufende Behandlung, Abschluss einer Ausbildung) kann das Gericht die Räumung für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr hinausschieben. Dabei berücksichtigt das Gericht vor allem die Dringlichkeit und Behebbarkeit der individuellen Belastung, die praktische Organisation eines Umzugs und etwaige Absprachen zwischen den Parteien.

3. Vollstreckungsschutz nach § 765a ZPO
Der Vollstreckungsschutz ist als „letztes Rettungsnetz“ ausgestaltet und greift nur in Ausnahmesituationen, in denen die Zwangsräumung nachweislich zu sittenwidrigen Folgen (z. B. akuter Lebensgefahr, Obdachlosigkeit in lebensbedrohlichem Maße oder schwerer psychischer Schädigung) führen würde. Die Beantragung des Vollstreckungsschutzes muss stichhaltig und aktuell begründet sein, wobei die Hürden noch deutlich höher als für Widerspruch oder Räumungsfrist liegen. (BGH, Beschluss I ZB 27/10)
VI. Rechte und Strategien der Mieter: Praktische Hinweise
Lassen Sie umgehend nach Zugang der Kündigung sämtliche Rechtsfristen prüfen – vor allem für den Widerspruch nach § 574 BGB und die spätere Antragstellung auf Räumungsfrist oder Vollstreckungsschutz.
Reichen Sie alle Belege, Nachweise und Erläuterungen gesammelt und geordnet ein, um den Abwägungsprozess zugunsten Ihrer Belange zu unterstützen. Im Zweifel ist eine anwaltliche Beratung noch vor Ablauf der Widerspruchsfrist zu empfehlen, um mögliche Formmängel und materielle Lücken frühzeitig zu entdecken und gezielt zu schließen.
Bleiben Sie – bei allem gebotenen Selbstbewusstsein – sachlich in Ihrer Kommunikation, vermeiden Sie persönliche Angriffe und nehmen Sie bei unklaren Punkten möglichst rasch Kontakt zum Vermieter oder dessen Interessenvertreter auf, um sachgerechte Lösungen „im Guten“ nicht von vornherein zu verhindern.

VII. Hinweise und Risiken aus Vermietersicht: Fehler vermeiden, Chancen nutzen
Schildern Sie den Eigenbedarf so detailliert und konkret wie möglich – sowohl im Hinblick auf die begünstigte Person als auch auf die Motivation, Dringlichkeit und Dauer des geplanten Einzugs.
Überlegen Sie vor Kündigung, ob alle Alternativen ausgeschöpft sind (z. B. Mietaufhebungsvertrag mit Umzugspauschale, Vermittlung von Ersatzwohnraum, Duldung einer längeren Übergangsfrist).
Sollten Sie im Verlauf des Kündigungs- oder Widerspruchverfahrens feststellen, dass sich Ihre Lebensplanung oder die Fähigkeit der Bedarfsperson grundlegend geändert hat, zeigen Sie dies umgehend schriftlich an, um Rechtsnachteile oder Schadenersatzpflichten zu vermeiden.
VIII. Zusammenfassung und abschließende Empfehlungen
Die Hürden für eine erfolgreiche Eigenbedarfskündigung sind sowohl in materieller als auch in formeller Hinsicht hoch und die gerichtliche Praxis spiegelt die Komplexität der jeweiligen Einzelfälle wider. Für Mieter wie Vermieter gilt: Je sorgfältiger Sie Ihre eigene Ausgangssituation, die vorhandenen Interessen und sämtliche Nachweise prüfen und dokumentieren, desto besser lässt sich der individuelle Anspruch durchsetzen bzw. abwehren. Konflikte können durch rechtzeitige Kommunikation, einen klaren rechtlichen Fahrplan und Offenheit gegenüber einvernehmlichen Lösungen oftmals entschärft werden – dies gilt selbst für langjährige und emotional besonders belastete Mietverhältnisse.

Hinweis: Diese Darstellung kann und soll eine individuelle Rechtsberatung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen. Im Streitfall empfiehlt es sich, anwaltlichen Rat in Anspruch zu nehmen und etwaige Fristen unbedingt zu wahren. Rechtsanwalt Depenbrock aus Telgte ist für Sie in der Kanzeli Depenbrock jederzeit für eine Beratung erreichbar!
Bitte beachten Sie: Die Inhalte unserer Website dienen ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzen keine qualifizierte Rechtsberatung, die auf die speziellen Gegebenheiten Ihres Einzelfalls eingeht. Die Rechtslage kann sich durch neue Gerichtsurteile oder gesetzliche Änderungen stets ändern. Sollten Sie eine verbindliche juristische Meinung oder eine persönliche Beratung wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Treten Sie jederzeit mit uns in Kontakt.
Weitere Artikel entdecken
Ihr Recht ist alternativlos.
Gemeinsam setzen wir es durch.
Buchen Sie jetzt Ihre rechtliche Erstberatung und sichern Sie sich mit mir einen Verbündeten für Ihr Recht.
Bei Notfällen (richterliche Durchsuchungsanordnung, Verhaftung, Eilanträge etc.) sind wir rund um die Uhr unter der Durchwahl -24 erreichbar.
Bitte nutzen Sie diese Nummer ausschließlich in echten Notfällen – für allgemeine Anfragen wählen Sie bitte die
02504 987990